Der französisch-portugiesische Künstler Wilfrid Almendra zeigt in der Kunsthalle Lingen Arbeiten an der Schnittstelle von Natur und Zivilisationsraum
„Where the Sun Pauses“, zu Deutsch etwa „Wo die Sonne innehält“, lautet der Titel einer Einzelausstellung, mit der der französisch-portugiesische Künstler Wilfrid Almendra zur Zeit die großzügig bemessenen Ausstellungsräume der Kunsthalle Lingen bespielt. Ein poetisch klingender Titel. Aber stellen wir uns einmal vor, was wirklich passieren würde, wenn die Sonne plötzlich innehalten würde. Bereits nach acht Minuten würden wir die plötzliche Inaktivität unseres Zentralgestirns bemerken. Denn so lange braucht das Licht, bis es auf der Erde ankommt. Dann aber würde überall auf der Welt die Photosynthese zum Stillstand kommen. Sämtliche Pflanzen würden aufhören zu wachsen und Sauerstoff zu produzieren. Nach einer Woche betrüge die weltweite Durchschnittstemperatur nur noch 0° Celsius. Nach einem Jahr wären alle Meere komplett zugefroren und jegliches Leben auf der Erdoberfläche verschwunden.
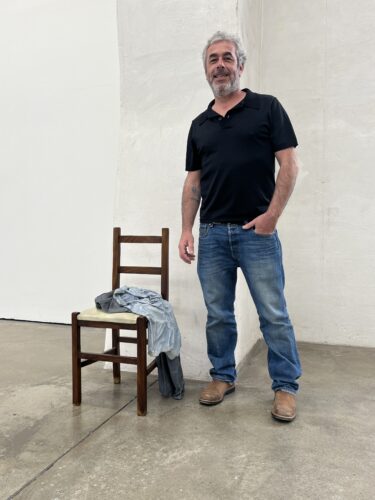
Porträt Wilfrid Almendra, Foto: Heiko Klaas
Wilfrid Almendra allerdings ist alles andere als ein pessimistischer Mensch. Und so vermittelt der von ihm gewählte Ausstellungstitel auch nicht unbedingt die Aussicht auf dystopische Schreckensvisionen, sondern eher das Gefühl eines kurzen Innehaltens und die damit verbundene Hoffnung auf eine bessere, weil gerechtere Welt. Vor allem aber lädt seine Präsentation in Lingen zum genauen Hinschauen ein. Der Künstler legt Fährten, die unter anderem in seine Biografie hineinführen. Die visuellen Köder zu weiterführenden Narrativen auszubauen, das überlässt er aber seinem Publikum. Entstanden ist die Schau in enger Zusammenarbeit mit der Fondation Pernod Ricard in Paris.
Nicht alles, was die Betrachter:innen auf den ersten Blick zu erkennen glauben, ist das, was es zu sein scheint. So zum Beispiel die auf dem Boden der Kunsthalle verstreut liegenden Orangen in verschiedenen Reifegraden. Manche noch ein wenig grün, andere offenbar voll ausgereift. Wer vermutet, hier werde unachtsam mit wertvollen Lebensmitteln umgegangen, täuscht sich. Alle Früchte wurden vom Künstler individuell in Aluminium ausgegossen und sorgsam mit der Hand bemalt. „Poor Harvest“ (2025), lautet der Titel dieser Arbeit, der sich auf die klimabedingt schlechten Ernteerträge im letzten Jahr bezieht.

Poor Harvest, 2025, Aluminiumguss, Acrylfarbe
Maße variabel, courtesy Wilfrid Almendra und Ceysson & Bénétière, Foto: Roman Mensing, artdoc.de
Und bereits hier kommt eine (auto-)biografische Komponente ins Spiel, die charakteristisch für die Arbeitsweise Almendras ist. Orangen züchtet er nämlich selbst, seit er vor 20 Jahren, die in Casario im Norden Portugals gelegenen Ländereien seiner Familie zurückerworben hat. Sein Vater hatte das über Jahrzehnte autoritär regierte Land schon in den 1960er Jahren aus politischen Gründen verlassen. Wilfrid Almendra kam daher 1972 in der Kleinstadt Cholet im Westen Frankreichs zur Welt. Zwei Jahre später sollte sich Portugal im Zuge der sogenannten „Nelkenrevolution“ von der faschistischen Diktatur befreien. Doch zurückgekehrt ist seine Familie zunächst nicht. Almendras Vater war Auslieferungsfahrer für Heizöl. Der Sohn half ihm gelegentlich. Sozialisiert wurde er daher im Bewusstsein, sowohl der Arbeiterklasse anzugehören, als auch der französischen Bevölkerung mit ausländischen Wurzeln. Nach einem Studium der freien Kunst in Lissabon, Manchester und Rennes, das er im Jahr 2000 beendete kann er heute auf zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen zurückblicken. So wurden seine Werke bereits auf der Manifest 13 in Marseille oder im Pariser Palais de Tokyo ausgestellt.

Wilfrid Almendra
Where the Sun Pauses
Installationsansicht Kunsthalle Lingen 2025, Foto: Roman Mensing, artdoc.de
Was Wilfrid Almendra in Lingen zeigt, sind verschiedene Annäherungen an sein eigenes Leben, in welchem sich Kunst und Alltag subtil miteinander verbinden. Die proletarische Herkunft seines Vaters, das Hin- und Hergerissensein zwischen Frankreich und Portugal, Stadt und Land, der Aufstieg zu einem international anerkannten Künstler und die intensive Beschäftigung mit handwerklichen Techniken und alternativen Ökonomien. All diese Faktoren fließen in seine Werke mit ein und bestimmen deren Erscheinungsweise. So verwendet er auch in der Lingener Ausstellung so gut wie keine neuen Materialien. Fast alle von ihm benutzten Werkstoffe stehen am Ende ihres Verwendungszyklus’. Oftmals stammen sie aus den zeitweise landwirtschaftlich genutzten Zwischenzonen zwischen Stadt und Land, Habitaten, die fragmentiert und zerschnitten sind durch Autobahnböschungen und Bahntrassen. Landschaften also, die Almendra bei seinen zahlreichen Reisen durch Europa immer wieder durchquert und gleichsam künstlerisch untersucht. Sein ausdrückliches Interesse gilt solchen allgemein als „Nicht-Orte“ wahrgenommenen Zonen, denen nur ein geringer ästhetischer oder funktionaler Wert beigemessen wird.

Wilfrid Almendra
Where the Sun Pauses I,
courtesy Wilfrid Almendra und Ceysson & Bénétière, Foto: Roman Mensing, artdoc.de
In der Regel erhält er seine Werkstoffe im Rahmen von Tauschgeschäften. So zum Beispiel auch die in der Lingener Ausstellung omnipräsenten großen Glasscheiben, die einst Bestandteile von Gewächshäusern waren. Almendra benutzt sie wie Leinwände, wenn er zum Beispiel auf Brachland eingesammelte und sorgsam getrocknete Klatschmohnpflanzen und anderes „Begleitgrün“ der Agrarindustrie untrennbar zwischen zwei Glasplatten einklemmt, mehrere dieser Platten, in einer Reihe an der Wand lehnend, aufstellt und damit eine Ahnung von Landschaft und Horizont simuliert. Kleine malerische Akzentuierungen auf dem Glas betonen dabei noch die Intensität der Pflanzenfarben. Dennoch verströmen diese Arrangements auch etwas Melancholisches, gehört doch der Mohn zu den wenigen Pflanzen, die sich angesichts des inflationären Einsatzes von immer neuen und hochwirksamen Pestiziden noch als einigermaßen resistent erweist und auf Ausweichflächen überlebt. Doch um pure Zivilisationskritik geht es Wilfrid Almendra nur nebenbei. Er entdeckt Schönheit und Anmut gerade auch im langläufig als „kaputt“ bezeichneten Ausschuss unserer Zivilisationsgeselschaft.

Wilfrid Almendra
Where the Sun Pauses I (Detail), courtesy Wilfrid Almendra und Ceysson & Bénétière, Foto: Roman Mensing, artdoc.de
Mitunter verdichtet er die Platten zu immer neuen Zusammenstellungen und raumgreifenden Installationen, indem er sie wie Raumteiler oder Paravents benutzt und diese Ensembles mehr oder weniger frei stehend in der ansonsten leeren, nur von einigen Betonpfeilern gegliederten Ausstellungshalle präsentiert. Entweder auf dem nackten grauen Betonboden. Oftmals aber auch in Kombination mit Bodenplatten, etwa aus „pierre de Bavière“ – so lautet die französische Bezeichnung für die sogenannten Solnhofener Platten. Einen Naturwerkstein also, der sich häufig durch kleine Fossilienabdrücke auszeichnet und als preiswerte Alternative zu Marmor oder Granit verwendet wird. Wilfrid Almendra erhält diese Materialien von befreundeten Personen, die sich auf das Sammeln und die Wiederverwertung von ausgedienten Wertstoffen spezialisiert haben. Allerdings ohne dafür mit Geld zu bezahlen. Die Logik des Kapitalismus, wonach allein Geld als Maßstab für den Wert von Waren und Dienstleistungen fungiert, negiert er. Seine bevorzugte Tauschwährung dagegen sind hochwertige, selbst produzierte landwirtschaftliche Produkte wie Bio-Orangen, Kartoffeln oder kaltgepresstes Olivenöl.

Wilfrid Almendra: Repos, 2023
Bronze, Aluminiumguss, Acrylfarbe
86 x 40 x 40 cm, courtesy Wilfrid Almendra und Ceysson & Bénétière, Foto: Roman Mensing, artdoc.de
Andere Arbeiten Wilfrid Almendras sehen wie vermeintliche Readymades aus. So etwa die Arbeit „Repos“ (2023), bestehend aus einem einfachen Holzstuhl, wie man ihn sich gut im Atelier des Künstlers vorstellen könnte. Darauf beiläufig abgelegt sind eine verschlissene Arbeitshose und ein abgenutztes, verschwitzt wirkendes T-Shirt. Doch wie im Fall der Orangen haben wir es auch hier wieder mit einem Aluminiumguss zu tun, der von Almendra in perfekter Trompe-l’œil-Technik bemalt wurde.

Wilfrid Almendra: Repos, 2023
Bronze, Aluminiumguss, Acrylfarbe
86 x 40 x 40 cm, courtesy Wilfrid Almendra und Ceysson & Bénétière, Foto: Heiko Klaas
Teilweise erinnern diese minutiös mit der Hand gefertigten Arbeiten an Werke des amerikanischen Bildhauers Robert Gober, Jahrgang 1954, der seine Nachbildungen von Haushalts- und Gebrauchsgegenständen aber meist surreal auflädt und so häufig Szenarien des Unheimlichen erschafft. Anders bei Wilfrid Almendra. Seine Werke erinnern auch nicht an die von Design- und Warenästhetik beeinflussten, „cleanen“ bildhauerischen Arbeiten vieler seiner Kolleg:innen, die mit stylish daherkommenden Werken in mehr oder weniger hohen Auflagen für einen globalen Kunstmarkt produziert werden, der diese begierig aufsaugt.
Wilfrid Almendras Arbeiten hingegen entziehen sich ihrer unendlichen Reproduzierbarkeit. In der Abgeschiedenheit des Studios praktizierte handwerkliche Verfahrensweisen bevorzugt er eindeutig gegenüber der Delegierung einzelner Produktionsschritte an industrielle Partner. Eine jahrzehntelang im Treibhaus verwendete Glasscheibe verfügt nun einmal über individuelle Einschreibungen in Form von Kratzern, Sprüngen, Rissen oder Verunreinigungen. Wilfrid Almendra stellt diese Materialien samt ihrer Blessuren ungeschützt aus. Sockel oder Absperrungen gibt es so gut wie keine. Die Betrachter:innen müssen in dieser Ausstellung aufpassen, nichts zu beschädigen oder zum Umsturz zu bringen.

Sing and Cry Little Bird, 2025
Glas, Alumiumguss, Acrylfarbe, Pflanze, verzinkter Stahl, Bayrischer Stein
140 x 220 x 220 cm
courtesy Wilfrid Almendra und Ceysson & Bénétière, Foto: Roman Mensing, artdoc.de
Eine herausragende Stellung innerhalb der Lingener Ausstellung nimmt auch die Arbeit „Sing and cry Little Bird“ (2025) ein. Wilfrid Almendra kombiniert hier einen gebrauchten, metallenen Hochsitzstuhl, wie er von Bademeistern oder Schiedsrichtern beim Tennis verwendet wird, mit dem lebensgroßen Aluminiumabguss eines prächtigen männlichen Pfaus, den er auf der Metallstruktur thronen lässt. Je nach kulturellem Kontext wird dieser ursprünglich auf dem indischen Subkontinent beheimatete Vogel als Symbol der Schönheit und Unsterblichkeit, aber auch des Hochmuts und der Eitelkeit gesehen. Almendras Arbeit lässt diese ambivalente Aufladung in der Schwebe.
Die französische Autorin und Kuratorin Liza Maignan schlägt in ihrem Begleittext zu der Ausstellung folgende Lesart vor: „Der Körper des Arbeiters hat sich in Luft aufgelöst und wurde durch einen majestätischen Vogel ersetzt – einen stillen Schiedsrichter über den Lauf der Zeit, über die Hierarchie der Formen, Körper und Objekte – vergleichbar mit dem hierarchischen Ungleichgewicht in unseren Gesellschaften – oder auch der Choreografie des sich vermischenden Lichts – zwischen ihnen – zwischen den Kunstwerken – zwischen den Körpern und Blicken – und den Zwischenräumen innerhalb der Architektur der Kunsthalle Lingen.“

Wilfrid Almendra: Model Home Sonata XX, courtesy Wilfrid Almendra und Ceysson & Bénétière, Foto: Roman Mensing, artdoc.de
Arbeiten einer anderen Werkreihe werden dann wieder hängend an der Wand präsentiert. Sie tragen den Titel „Sonata“, jeweils versehen mit einer lateinischen Nummernfolge. In diesen, auf den ersten Blick an den Minimalismus erinnernden Werken untersucht Wilfrid Almendra eher kleinbürgerliche Träume vom Wohnen und Zuhausesein. Auf eine Sperrholzplatte mit bereits abblätternder, hellgrüner Farbe ist etwa ein eisernes Gitter montiert, wie es zum Beispiel in Vorstadtsiedlungen vor Kellerfenster geschraubt wird, um Einbrecher abzuschrecken. Einsätze und Applikationen aus farbigem Glas, wie es für Kirchenfenster verwendet wird, nobilitieren diese Ensemble dann allerdings wieder.

Wilfrid Almendra: Labor Day, 2023, courtesy Wilfrid Almendra und Ceysson & Bénétière, Foto: Roman Mensing, artdoc.de
Die Arbeit „Labor Day I“ (2023) bezieht sich wiederum auf das Feld der körperlichen Arbeit. Zwischen über zwei Meter hohe, an der Wand lehnende Glasplatten eingeklemmt sind einmal mehr Feld-, Wiesen- und Ackerpflanzen. Über den schweren Scheiben hängt jedoch, wie zum Trocknen aufgehängt, ein weißes ärmelloses Trikot-Unterhemd der Marke „Armor Lux“, wiederum ausgeführt als bemalter Aluminiumguss. Hat sich hier jemand am Ende eines langen Arbeitstages seiner Arbeitskleidung entledigt? Und was sagt der graue Schimmer auf dem Textil über die Arbeitsbedingungen dieser Person aus? Womöglich nimmt uns Almendra aber auch hier einmal mehr mit in sein Atelier, und wir haben es mit einer Art Selbstporträt zu tun.

Wilfrid Almendra: Labor Day, 2023, courtesy Wilfrid Almendra und Ceysson & Bénétière, Foto: Heiko Klaas
Ein wiederkehrendes Motiv in der Lingener Ausstellung stellen zudem Nacktschnecken dar, die Wilfrid Almendra in Form von lebensgroßen Bronzeabgüssen an verschiedenen Stellen auf den Wänden der Kunsthalle platziert. Von Landwirten und Hobbygärtnern ausschließlich als Schädlinge betrachtet, erscheinen sie hier jedoch eher als Metaphern für Weisheit, Langmut und Geduld, die allerdings im Gegensatz zu ihren mit einem stabilen Haus ausgestatteten Artgenossen auch eine gewisse Schutzlosigkeit und Ausgesetztheit ausstrahlen.

Wilfrid Almendra: Slugs, 2024 (Detail), courtesy Wilfrid Almendra und Ceysson & Bénétière, Foto: Heiko Klaas
In Wilfrid Almendras Werk und der sehr sehenswerten Lingener Ausstellung verdichten sich also ganz unterschiedliche Referenzhorizonte und Perspektiven. So etwa die Beziehungen zwischen Mensch und Natur, Agrarindustrie und Ökologie, zwischen entfremdeter und selbstbestimmter Arbeit oder kapitalistischer Geldwirtschaft und neu gedachten Modellen des Tauschhandels. Hinzu kommen Arbeiten, die sowohl die produktionsästhetischen Aspekte seiner Kunst, als auch die Rezeption seitens der Betrachter:innen multiperspektivisch untersuchen. Auf den ersten Blick naturalistisch wirkende Darstellungen oder vermeintliche Readymades entpuppen sich bei ihm als durch vielerlei Transformationen und Verfremdungseffekte erzeugte, hochkomplexe Artefakte, die die Poesie des Alltäglichen greifbar machen und die Wahrnehmung und dass Urteilsvermögen des Publikums auf die Probe stellen.

Wilfrid Almendra
Where the Sun Pauses
Installationsansicht Kunsthalle Lingen 2025, courtesy Wilfrid Almendra und Ceysson & Bénétière, Foto: Roman Mensing, artdoc.de
Auf einen Blick:
Ausstellung: Where the Sun Pauses
Ort: Kunsthalle Lingen
Zeit: bis 17.8.2025. Di-Fr 10-17 Uhr. Sa/So 11-17 Uhr
Katalog: Erhältlich ist eine Publikation aus dem Jahr 2023 in französischer und englischer Sprache, 158 S., zahlreiche Farbabb., 30 Euro
Internet: www.kunsthallelingen.de
www.ceyssonbenetiere.com

Poor Harvest, 2025
Aluminiumguss, Acrylfarbe
Maße variabel, courtesy Wilfrid Almendra und Ceysson & Bénétière, Foto: Heiko Klaas




