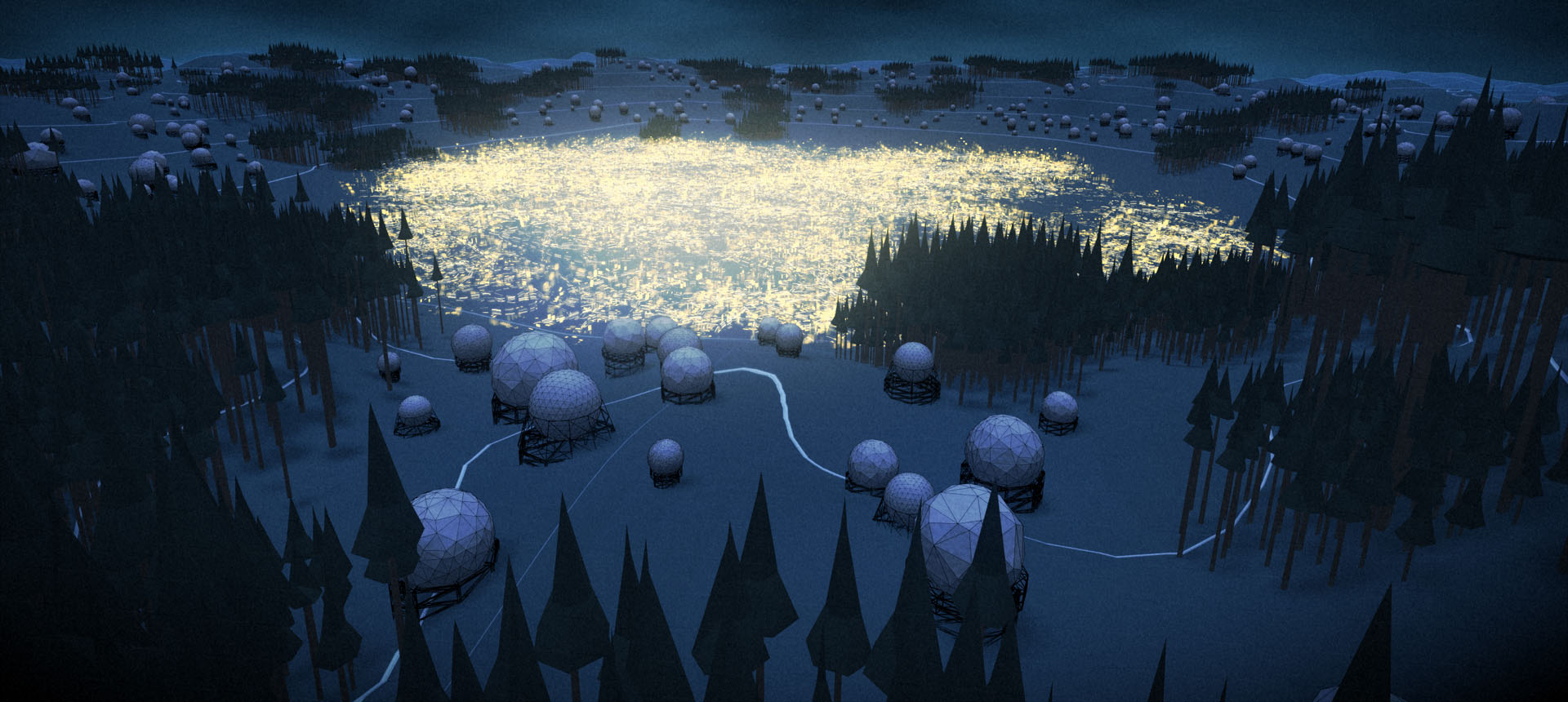Google Glass und Datenbrillen anderer Hersteller leiten einen Neustart des Sehens ein. Der menschliche Blick gewinnt computergestützt Informationen. Doch was verlieren wir, wenn wir nicht mehr auf unsere Augen hören?
Paris, am zwanzigsten September 1667. Der Polizeileutnant De La Reynie lädt zum Soiree ein. Er will der vornehmen Abendgesellschaft erklären, warum er auf Geheiß des Königs Louis XVI. die Straßenbeleuchtung eingeführt hat. „Helligkeit, Sauberkeit, Sicherheit“, lautet die Parole. Paris soll sich vom finsteren Moloch zur Weltstadt wandeln. Es herrscht eindringliche Stille. Wenig Gegenliebe bei den Gästen. Sie werten den Vorstoß als Eingriff in ihre Privatsphäre.
Graf Guiche schwingt das Wort. „Um neun Uhr schläft das ganz bürgerliche Paris, oder soll wenigstens schlafen; dem Übel gehört dann die Stadt, und uns kommt es zu, zu bestimmen, wie viel Licht wir zu unserem Thun bedürfen.“ Dieser Schlingel, denke ich beim Lesen der Aufzeichnungen von Georges Touchard-Lafosse.1 Graf Guiche wettert nur gegen die Maßnahme, um von seinen Liebesabenteuern bei Einbruch der Dunkelheit abzulenken. Dennoch schwillt der Groll bei den Gästen an. Die Neuerung sei nichts als ein willkürlicher Akt des Königs, um die Stadt unter Kontrolle zu bringen.
De La Reynie bleibt gelassen. Was geschieht? Der Polizeileutnant lässt 2.736 Laternen in der Stadt aufstellen. Paris geht bei Sonnenuntergang nicht mehr ins Bett. Sondern aus. Die Bewohner nutzen die Nachtstunden. Das Kulturleben blüht auf. Menschen fühlen sich sicherer, gehen in die Oper oder ins Theater. Straßenbeleuchtung? Anscheinend nicht so schlecht. Widerspenstige treten aus Protest die Laternen ein.
Ach, Technik
Die Anekdote erzählt: Nahezu jede Technik ist umstritten. Aus vielerlei Gründen. Unser Unbehagen scheint historisch in guten Händen zu sein. Denn egal ob Buchdruck, Telefon, Computer, Internet – alle Errungenschaften, die heute selbstverständlich sind, standen zu ihrer Zeit unter kritischem Vorbehalt, wie die Autorin Katrin Passig in ihrer Buch Standardsituationen der Technologiekritik bemerkt.2 Unsere Fragen verlaufen sich meist in abgezirkelten Bahnen. Wir entwerten Gestell und Benutzer, wie jetzt auch bei Google Glass: Was bringt mir das? Wer braucht das schon! Außer eine Handvoll Nerds. Das Ding sieht eh optisch unterwältigend aus.
Plötzlich sind die „Nerds“ in der Mehrheit. Übrig bleibt noch die leicht bildungsbürgerliche Volte: Diese Technik beschleunigt den moralischen und kulturellen Verfall in der Gesellschaft! Kathrin Passig rät insgesamt zu mehr Gleichmut. Technik kommt, Technik geht. Und die Welt hat die seltsame Angewohnheit, trotzdem nicht unterzugehen.
Eine digital-humanistische Kehre
Puh, es ist schwierig aus dem deterministischen Zirkel auszubrechen. Warum zögern und zaudern? Dagegen sein – das ist auf Dauer nur nervig, innovationsfeindlich oder typisch deutsch. In schnellem Atemschlag folgt der Rüffel: Kulturpessimist! Auf der anderen Seite trägt eine Technik-Fetischisierung, die sich in magischer Verzückung äußert, wenig zu einer gehaltvollen Debatte dabei.
Das Feld für Argumente ist eng gesäumt. Je mehr Digitalismus in allen Lebenslagen eine normative Kraft entfaltet, desto mehr müssen wir unser Unbehagen erkunden dürfen. Unser Denken offener und ungesicherter gestalten. Wie kann man also eine Position einnehmen jenseits vorschneller Sympathie oder Verurteilung?
Ich möchte in diesem Beitrag eine alternative Auseinandersetzung mit Datenbrillen vorschlagen. Nicht für Technik und nicht gegen Technik im Allgemeinen. Sondern für Digitalismus. Für den Menschen. Sozusagen, eine Betrachtung aus dem Blickwinkel eines digitalen Humanismus heraus. Das heißt, den digitalen Wandel prinzipiell mit offenen Armen zu empfangen – und nicht rückgängig machen wollen. Jedoch bei den Fragen, was eine spezifische Technik mit mir macht und in welcher Fluchtlinie sie aufgeht, als Lobbyist des Menschlichen zu argumentieren. Nicht aus der Warte des Kritikers. Nicht aus der Bastion der Moral oder der Ökonomie heraus.
So muss Google nicht automatisch als Feindbild herhalten. Mag es auch nur ein Pflastersteinwurf weit entfernt sein. Google ist ein Unternehmen. Als solches weder gut noch böse und keinem ethischen Wertekanon verpflichtet. Es hat lediglich Interessen. Google ist ein Monopolist von Lebensaufzeichnungen, aber kein Monopolist der Sinnstiftung. Google macht Big Data zu Big Money. Getrieben von der womöglich techno-romantischen Vorstellung, mit Innovationen die Welt zu verbessern. Fair enough.
![Screenshot aus dem Video „London [through Google Glass]“. © Google](https://daremag.de/wp-content/uploads/2014/10/London-through-google-Glass-I1.jpg)
Screenshot aus dem Video „London [through Google Glass]“. © Google
![Szenen aus dem Video „London [through Google Glass]“. Wie jedes andere Unternehmen auch greiff Google in die Trickkiste der Erlebnispointen, um Produkte feilzubieten. „Never Miss A Moment“ – „Become an explorer!“ – „Made for the open road“, lauten Slogans zur Vermarktung von Google Glass Explorer Edition. © Google](https://daremag.de/wp-content/uploads/2014/10/London-through-google-Glass-II1.jpg)
Szenen aus dem Video „London [through Google Glass]“. Wie jedes andere Unternehmen auch greiff Google in die Trickkiste der Erlebnispointen, um Produkte feilzubieten. „Never Miss A Moment“ – „Become an explorer!“ – „Made for the open road“, lauten Slogans zur Vermarktung von Google Glass Explorer Edition. © Google
Ich nähere mich dem Ausgangspunkt meiner Argumentation. Der Zukunftsforscher Matthias Horx erklärt wortmächtig: „So geht Zukunft: Vermeintliche Revolutionen transformieren sich in humane Revolutionen. Durch die segensreiche Kraft des Zweifelns.“3 Soweit, so beunruhigend. Heißt das, wir müssen nur lange genug unsere Bedenken vortragen, dann löst sich alles in Wohlgefallen auf? Hat ja bisher gut geklappt beim Thema „Überwachung“. Was ist, wenn Datenbrillen unsere bisherige Vorstellung des Menschen antasten? Nicht nur eine kulturelle Errungenschaft wie die Privatsphäre aushöhlen – oder neutraler: neu verhandeln.
Nein, wenn diese spezifische Technik vor dem Horizont des digitalen Wandels selbst ein neues Bild vom Menschen hervorbringt. Wie können wir technologische Revolutionen dann überhaupt noch „human“ korrigieren?
Technik hat wie der Kapitalismus die Tendenz zur Universalisierung. Technik erzeugt weitere Technik und erhebt Schritt für Schritt Gültigkeitsanspruch in allen Bereichen. „Die Universalisierung der Technik beschert denjenigen, die sie herstellen, anbieten, betreiben und nutzen, einen Zuwachs an Macht, der asymmetrisch verteilt ist“, stellt Klaus Kornwachs in seinem Buch Philosophie der Technik: Eine Einführung fest.4 So ist es nicht verwunderlich, dass kaum Literaten, Künstler oder Philosophen zu Wort kommen, wenn es darum geht, unsere Zeit zu deuten.
Wollen wir den Menschen in der Gleichung nicht überflüssig werden lassen, müssen wir den Universalisierungsbestrebungen Einhalt gebieten. Ich bezweifle, dass Argumente überzeugen, die sich gegen Überwachung aussprechen. Sie richten sich indirekt an einem Pflichtenkanon aus, wie ein demokratischer Staat auszusehen hat oder wie wir zu sein haben. Nicht daran, wie wir tatsächlich sind, welchen Sehnsüchten wir recht geben. Die Besinnung auf das, was uns als Menschen ausmacht, die Sensibilität für Demütigungen anderer in der eigenen Lebenswirklichkeit, sind meines Erachtens bessere Augenöffner. Dazu müssen wir uns zunächst vergewissern, was wir eigentlich verteidigen, wenn wir sagen „Das ist unmenschlich“. Wir sind letztlich bei der Frage angelangt. Was ist der Mensch? Keine kleine Frage. Fangen wir an mit ein paar Ich-Ansichten.
Exzentrisch positioniert
Als Mensch begreife ich mich als unberechenbar, unergründlich, ambivalent. „Was allzu menschlich ist, manifestiert seine Schwäche und deren verstohlene Stärke“, schreibt Helmuth Plessner. Doch nicht nur das. Sein Konzept der „exzentrischen Positionalität“ formulierte der Philosoph, der zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist, 1928 in seinem Magnus Opus Die Stufen des Organischen und der Mensch und verfeinerte es bis zu seinem Tod 1985.5
Der Mensch ist ein „exzentrisch positioniertes“ Lebewesen. Was heißt das? Positionalität beinhaltet eine passiv eingefärbte Art von Gesetztheit – entgegen zum Beispiel einer radikalen Auffassung im deutschen Idealismus wie sie Johann Gottlieb Fichte vertrat: Ein autonomes Ich, das sich absolut selbst zu setzen vermag und nicht gegen seine Außenwelt abgegrenzt ist, gegen die es sich konstituiert. Was bedeutet „exzentrisch“? Das Tier zum Beispiel lebt aus seiner Mitte heraus in seine Mitte hinein. Es ist instinktsicher. Zentriert. Zwar „vermag er über den eigenen Leib Herrschaft gewinnen, es bildet ein auf es selbst rückbezügliches System, ein Sich, aber es erlebt nicht – sich“, schreibt Helmuth Plessner.6
Wir Menschen tun es. Wir können zu uns auf Distanz gehen. Selbstreflexion üben. Uns „von außen betrachten“. Aber wir entkommen uns nicht. Wir können nicht, in natürliche Grenzen gesetzt, aus uns vollständig heraustreten. Wir sind also zentrisch und exzentrisch zugleich. Diese Differenzierung bezeichnet Plessner auch als „Bruch“, als „Doppelaspekt“ des menschlichen Wesens. Der exzentrische Positionscharakter wirkt rückbezüglich in drei Sphären.
Innenwelt
Ich lebe und erlebe nicht nur, sondern erlebe auch mein Erleben. Doch letztendlich bleibe ich zerklüftet, gespalten im Beben meines Seins. Helmuth Plessner schreibt: „Wirkliche Innenwelt, das ist die Zerfallenheit mit sich selbst, aus der es kein Ausweg gibt.“7
Außenwelt
Ich bin ein Körper – meine menschliche Ausstattung ist an das Hier und Jetzt gebunden. Und ich habe einen Körper. Körperhaben bedeutet, sich selbst zum Gegenstand zu werden, sich reflektieren und die physische Gebundenheit zu ersetzen suchen. Der Philosoph Joachim Fischer macht diesen Zusammenhang bei Helmuth Plessner wie folgt verständlich: In einer Welt der Körper entdecke ich mich als einen Körper unter vielen, bin dabei aber rückgebunden in meine zu durchlebende Leibposition, in der ich bleibe.8
Mitwelt
In einer Mitwelt erkenne ich mich durch dich als Ich. Durch den Anderen grenzrealisiere ich mich. Ich gehe in einer Mitwelt auf und forme sie, aber ebenso formt mich die Mitwelt. Dennoch bleibe ich verhaftet an die Eigenperspektive meiner Ich-Position.
Der Mensch – Eine Erzählung
„Die Figur des sich selbst verborgenen Menschen, der Homo absconditus, bildet das Leitmotiv von Plessners Untersuchungen“, fasst der Autor Khosrow Nosratian zusammen.9
Der Mensch bleibt sich ein ewiges Rätsel, das er zu entschlüsseln sucht. Eine Quintessenz seines eigenen Wesens gibt es nicht. Die Forderung nach Authentizität ist hinfällig, da das Ich im stetigen Wandel begriffen ist. In der Schwebe. Unvollendet. Deshalb darf er sich in verschiedenen Rollen erproben. Sich die Chance auf Veränderung wahren. Sei es in der Liebe, der Sexualität, dem Denken, Fühlen oder im Glauben. Bis zum Tod, der dem Leben einen Schluss setzt.
Helmuth Plessner annonciert: „Ein Lebewesen exzentrischer Positionalität hat zu existieren, sein Leben in die Hand zu nehmen und unter Einsatz aller seiner Möglichkeiten die Mängel auszugleichen, welche sein Positionscharakter mit sich bringt: Schwächung der Instinkte, Objektivierung bis zur Verdinglichung, Entdeckung seiner selbst.“10
Auf der Suche nach Sinn, erfinden wir Sinn. Der Mensch erzählt sich. Der Mensch ist eine Erzählung. Ich habe Geschichte, ich schreibe Geschichte. Ich hebe mich als Erzählung ab – aus meiner natürlich begrenzten Disposition heraus, die ich übertreten möchte. Im Widerspruch, im Ringen mit mir, bin ich dabei in meiner Mitte.
Helmuth Plessner verdeutlicht weiter: „Die Verborgenheit des Menschen für sich selbst wie für seine Mitmenschen ist die Nachtseite seiner Weltoffenheit. Er kann sich nie ganz in seinen Taten erkennen – nur seinen Schatten, der ihm vorausläuft und hinter ihm zurückbleibt, einen Abdruck, einen Fingerzeig auf sich selbst. Deshalb hat er Geschichte. Er macht sie, und sie macht ihn.“11
Darüber hinaus kann ich neue Eigenschaften, neue Deutungen für mein Leben entwickeln, die nicht zurückfahrbar sind auf meine bisherigen Erfahrungen und Begierden, die ich in der Summe gemacht habe. Das geschieht zum Beispiel durch zufällige Ereignisse. „Alles Neue, das uns überrascht, ist ein Ereignis“, erklärt Alain Badiou im Interview mit dem Philosophiemagazin Hohe Luft.12 „Es ist das fundamental Neue, das sich nie mit dem Alten in der Welt begründen lässt. [ … ] Das Ereignis ist seinem Wesen nach immer undenkbar und kontingent: möglich, aber nicht notwendig.“ Es können Schicksalsschläge sein, Paradigmenwechsel und vor allem auch unerwartete Begegnungen mit Menschen.
Ich fasse zusammen: Wenn wir den Menschen als Erzählung begreifen, der Körper ist und hat; in einer Mitwelt aufgeht, in der Leben sich Selbst- und Miterleben heißt. Dann können Datenbrillen vor dem Hintergrund einer fortschreitenden Digitalisierung eine Umdeutung vornehmen, an dessen Ende steht: Der Mensch als Aufzählung, der Mensch ohne Körper, der Mensch ohne Mitwelt.
1 + n = Ich?
Datenbrillen koppeln das menschliche Auge mit dem Internet. Sie werten Daten aus, die sie aus unserem Sichtfeld gewinnen und vernetzen sie zu nutzbaren Informationen. Die Übernahme des Sehens erfolgt dabei durch die Disziplinen Metrik, Ökonomie und Informatik.
Qualitative Begriffe wie Sinnlichkeit, Eleganz oder Anmut sind diesen Systemen fremd. Zu diffus. Sie arbeiten lieber mit quantitativen Methoden. Sie addieren, zählen eins und null zusammen, vergleichen. Alles, was dabei nicht verwertbar, berechenbar, operationabel ist, stört den Fluss des Funktionierens. „Google Glass totalisiert die Jägeroptik, die alles ausblendet, was keine Beute ist, das heißt keine Information verspricht“, schreibt der Philosoph Byung-Chul Han in seinem Buch Im Schwarm. „Dank der Datenbrille erreicht die menschliche Wahrnehmung eine totale Effizienz.“13
Wir werden als Träger von Tech-Brillen zu Erntemaschinen von Daten degradiert. Wir erteilen Schürfrechte zu unserem Unterbewussten. Mit dem Versprechen eines Tages Zugang zu mannigfaltigem Wissen zu erhalten, wenn wir nur ad infinitum alles aufzeichnen, teilen und uns vernetzen.
So bemerkt der Philosoph Byung-Chul Han in seinem Buch Psychopolitik: „Big Data suggeriert ein absolutes Wissen. Alles ist messbar und quantifizierbar. Dinge verraten ihre geheime Korrelation, die bisher verborgen waren. Genau voraussagbar soll auch das menschliche Verhalten werden. Es wird eine neue Ära des Wissens verkündet. Korrelationen ersetzen Kausalität. Es-ist-so ersetzt Wieso. Die datengetriebene Quantifizierung vertreibt den Geist aus dem Wissen.“14
Chris Anderson, der Chefredakteur des technikverliebten Wired-Magazine, hat dieses Szenario als „das Ende der Theorie“ bereits vor fünf Jahren ausgerufen: „Dies ist die Welt, in der Big Data und angewandte Mathematik jedes andere Erkenntnis-Werkzeug ersetzen. Wer weiß schon, warum Menschen sich so und nicht anders verhalten? Der Punkt ist, sie tun es, und wir können es mit beispielloser Genauigkeit messen und erfassen. Wenn wir nur genug Daten haben, sprechen sie für sich selber.“15
Daten sprechen also für sich selber. Das bedeutet: Big Data ersetzt die Vernunft, den Geist, wie Byun-Chul Han resümiert. Diese Allmachtsphantasie beschwört ein Endspiel für Menschlichkeit herauf. Denn wir sind dabei den Mensch als Aufzählung, als Addition zu begreifen. Die reduktionistische Rechen– nicht Lesart verkennt erstens, dass wir als Menschen in unserer Vollständigkeit nicht durch Korrelation zu entschlüsseln ist.
Zweitens, schreiben wir den Menschen in seiner Entwicklung fest, genau genommen deckeln wir sie, wenn wir Algorithmen als Sinninstanz auf den Thron der Erkenntnis setzen. Algorithmen liefern „Vorhersagen“. Sie arbeiten mit statistischen Modellen und Wahrscheinlichkeiten, die aus historischen Daten abgeleitet werden. Doch Lebensmuster, die in der Vergangenheit nicht auftreten, können als zukünftige Erscheinung nicht vorausgesagt werden.
Warum überhaupt noch der Versuch, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, seiner Existenz Sinn verleihen, wenn uns Daten aufgrund von Herkunft, Bildungsstand oder Neigungen festschreiben?
Zuletzt, geht die Kausalität der Körper verloren. Es macht einen Unterschied, ob sie einem Menschen im Raum begegnen oder nur noch durch Oberflächen erfahren. Das erscheint banal, die Wirkungsverhältnisse von Körperlichkeit sollten aber beachtet werden.
Der zerlegende Blick
Datenbrillen ist der Blick der Addition eigen. Das Sehen wird in seine auswertbaren Teile zerlegt. Wir brauchen nicht mehr auf unsere Augen zu hören, wenn uns eingeblendet wird, was kontextuellen Sinn ergibt. „Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist…“ – so lautet die digitale Spielart.
Wir rauben dem Sehen den Dreiklang von Erleben, Ausdruck und Verstehen, weil Datenbrillen Gesehenes gleich ein Verstehen andichten. Ein Verstehen, das sich leidenschaftslos auf Daten stützt. Doch gerade im Verstehen muss ich mich selbst zum Einsatz bringen, sonst droht der „kognitive Kontrollverlust“, wie es der Chefredakteur Thomas Vašek der Philosophiezeitschrift Hohe Luft formuliert.
Werden wir Dinge mit der Zeit noch in Augenschein nehmen, wenn sie uns nur noch in ihrer bisherigen Vertrautheit, ihrer nackten Körperlichkeit erscheinen? Datenbrillen verleiten uns dazu, nach einem Mehr an Information Ausschau zu halten. Nach Körperkonturen mit verwertbarem Informations-Bonus. Wir werden unser Umgebung abscannen. Der Augenblick gerinnt zum Datenblick. Körper werden paradoxerweise konturlos, weil sie im Hier und Jetzt in ihrer ursprünglichen Form entmaterialisiert werden. Sie geraten buchstäblich „out of focus“, wie Robin Williams in dem Film „Harry außer sich“ (Englisch: Deconstructing Harry). Wir schauen nur, aber sehen nichts. Doch was entgeht uns, wenn wir unsere Augen für das Gegenüber nicht mehr scharf stellen?

„I’m out of focus“. Dieses Schicksal ereilt Robin Williams in seiner Rolle als Schauspieler in dem Woody-Allen-Film „Deconstructing Harry“ als er sich zeitweise nicht beachtet und wertlos fühlt.
Das Rätsel des Anderen
„Der Mensch wird am Du zum Ich“, schreibt Philosoph Martin Buber. Er ist ein soziales Wesen, das durch Anerkennung und Demütigung geformt wird. Die Philosophin Heidi Salaverría hebt hervor: „Durch Anerkennung werden wir Teil der sozialen Welt, für andere wahrnehmbar und von ihnen wertgeschätzt“.16 Unsere Gesichter sind dabei ein wichtiges soziales Werkzeug.
Heidi Salaverría bezieht sich in ihren Untersuchungen unter anderem auf Emmanuel Levinas, der im „Antlitz des Anderen“ eine „Spur des Unendlichen ausmacht“. Der französische Philosoph hat diesen wunderbaren Satz formuliert: „Einem Menschen begegnen heißt von einem Rätsel wachgehalten zu werden.“17
Einem Menschen zu begegnen, heißt ihn als Anderen erleben, zu entdecken und durch seine unendlich vertraute Fremdheit auf sich selbst zurück geworfen zu werden. „Angesichts des anderen Menschen, der Freiheit des Anderen, wird das Ich vorübergehend aus der Fassung gebracht. Der Andere übersteigt unser Ich und löst in uns starke, durchaus widersprüchliche Impulse aus.“ schreibt Salaverría über die Gedanken, die sich Lévinas zum Antlitz des Anderen gemacht hat.
Haben Sie jemals einem geliebten Menschen tief in die Augen geschaut? Über Minuten hinweg? Bestimmt. Ich habe es erst nicht ausgehalten. Das Gefühl von Nähe, Vertrautheit, der unergründliche Marianengraben, der sich in den Augen des Anderen auftat. Nach ein paar Sekunden öffnen sich die Schleusen hinter dem Staudamm des Denkens.
„Vielleicht weil es dich nur als den Einen gibt. Hinter dem das Viele liegt“, dichtet die Band Ja, Panik. Der Andere zeigt sich sich nackt und fremd zugleich. In diesem Augenblick wird er für mich zum Mit-Menschen – ihm gilt meine Empathie, Zuneigung und Verantwortung.
Wir sollten es nicht Datenbrillen überlassen, das Rätsel des Anderen zu entschlüsseln. Obwohl das Gesicht immer auswertbarer wird. Forscher der Universität Uppsala haben 2000 herausgefunden, dass der Anblick glücklicher, neutraler oder wütender Gesichter für nur 30 Millisekunden, bei uns zu Gesichtsmuskelreaktionen führen, die den glücklichen und wütenden Gesichtern korrespondieren.18 Sie sprechen von unbewusster Nachahmung, sogenannter Mimikry. Der Gesichtsausdruck lässt sich einerseits in Sekundenbruchteilen auswerten, wenn man ihn aufzeichnet, und andererseits arbeiten Forscher daran, das wechselseitige Verhältnis zu beleuchten.
Gesichtserkennungssoftware wird es für Google Glass nicht geben. Google hat bereits abgewiegelt. Am 19.07.2014 hat das Unternehmen ein Patent für „Face Recognition“ angemeldet. Der Nutzer kann eine visuelle Suchanfrage starten, zum Beispiel ein Foto mit dem Handy einschicken und bekommt von dem System passende Treffer angezeigt. Wie einfach der Vorgang mit Google Glass wäre, muss man sich nicht ausmalen.
Der fremde Blick ist ein Spiegel, in dem wir uns selbst bewusst werden. Träger von Datenbrillen sind Egoisten. Sie entziehen sich dem reflexiven Verhältnis, das dem Blickkontakt innewohnt.
Und jetzt?
Der Mensch geht auf in einer digitalen Welt, die alleine auf seine Bedürfnisse aber noch nicht auf seine Bedürftigkeit zugeschnitten ist.
Die Frage ist, ob wir uns den neuen digitalen Lebensraum nicht zu eigen machen wollen, in dem wir selbstverständlich alles auf uns beziehen. Zu einer menschlichen Bedingung machen.
Google Glass und andere Datenbrillen in diesem Sinne zu nutzen, bedeutet, es für sich bewusst als Mittel zum Zweck zu entdecken. Sich explizite Gründe zu schaffen, wieso man das Visier aufsetzt. Sei es um den schnellsten Weg zum Flughafen zu finden, einen geführten Rundgang durch ein Museum zu bestreiten, für den medizinischen Einsatz oder von mir aus um ein Action-Rafting-Video zu drehen. Verkommt das Werkzeug zum Selbstzweck, das heißt, es wird ein unbewusstes Tool zur Welterfassung, durch das eigenes Sehen, Erkennen und Verstehen ausgelagert wird, dann beschleunigen Sie als Träger die Entwicklung hin zu einer Wirklichkeit ohne Körper, ohne Mitwelt und das Rätsel des Anderen. Sie defragmentieren den Menschen und in seine Bestandteile und glauben paradoxerweise ihn in seiner Vollständigkeit und seinen Zusammenhängen erfasst zu haben.
„Poetry is what is lost in translation“, dichtete Robert Frost. Sind Datenbrillen gute Dolmetscher der Sinnlichkeit? Das entscheiden Sie, wenn Sie das nächste Mal einem Menschen in die Augen blicken. Mit – oder ohne Datenbrille. Sie haben die Wahl!
Titelbildnachweis
 Tech Noir erstellt Cinemagraphs – lebende Bilder aus Filmszenen. Für diesen Beitrag hat Tech Noir ein Cinemagraph aus dem brillanten deutschen Film Love Steaks animiert.
Tech Noir erstellt Cinemagraphs – lebende Bilder aus Filmszenen. Für diesen Beitrag hat Tech Noir ein Cinemagraph aus dem brillanten deutschen Film Love Steaks animiert.
Zu sehen sind die beiden Schauspieler Lana Cooper und Franz Rogowski. Mehr Arbeiten von Tech Noir finden Sie unter: http://technoir.nl. Den Trailer zum Film Love Steaks von Jakob Lass können Sie hier anschauen: http://youtu.be/_tOiEuKSrsM
Quellenangaben
George Touchard-Lafosse, Pariser Nächte. Eine Gallerie galanter Abenteuer geheimer Liebes- und anderer Geschichten der Pariser Großen, 1838, S. 5. ↩
Katrin Passig, Standardsituationen der Technologiekritik. Merkur-Kolumnen, Berlin 2013 ↩
Matthias Horx, »Horxkolumne: Die „Digitale Revision“«, in: trendupdate, Ausgabe 02/2014, S. 9. ↩
Klaus Kornwachs, Die Philosophie der Technik – Eine Einführung [Kindle Edition], München 2013, Position: 1353 ↩
Vgl. Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie, Berlin 1928: 1975. ↩
Helmuth Plessner, Mit anderen Augen. Aspekte einer philosophischen Anthropologie, Stuttgart 1982, S. 9. ↩
Ebd., S. 13. ↩
Vgl. Joachim Fischer, »Exzentrische Positionalität – Plessners Grundkategorie der Philosophischen Anthropologie«, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Band 48, 2000, S. 265-288; online unter: http://www.fischer-joachim.org/exzentrischepositionalitaet.pdf ↩
Nosratian Khosrow, »Bücher zu Helmuth Plessner«, 2001; online unter: http://www.deutschlandfunk.de/buecher-zu-helmuth-plessner.730.de.html?dram:article_id=101530. Stand: 10.10.2014 ↩
Helmuth Plessner, Mit anderen Augen. Aspekte einer philosophischen Anthropologie. Stuttgart 1982, S. 142. ↩
Helmuth Plessner, »Homo absconditus«, in: Gesammelte Schriften, hg. von Günter Dux / Odo Marquard / Elisabeth Stöcker. Band 8: Condition humana. Frankfurt am Main 1969, S. 359. ↩
André Behr / Patrizia Hausherr, »Herr Badiou, warum zünden Sie keine Banken an?«, in: Hohe Luft, Philosophie-Zeitschrift, Ausgabe 6/2014. S. 51 – 57. ↩
Byung-Chul Han, Im Schwarm. Ansichten des Digitalen, Berlin 2014, S. 60. ↩
Byung-Chul Han, Psychopolitik. Neoliberalismus und die neuen Markttechniken. Frankfurt am Main 2014, S. 92 ff. ↩
Chris Anderson, »The End of Theory. The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete«, 2008; online unter: http://archive.wired.com/science/discoveries/magazine/16-07/pb_theory. Stand: 10.10.2014 ↩
Heidi Salaverría, „Schön, dich zu sehen!“, in: Hohe Luft, Philosophie-Zeitschrift, Ausgabe 5 / 2013, S. 76 – 81. ↩
Emmanuel Lévinas, Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie, 2012, S. 120. ↩
Ulf Dimberg / Monika Thunberg / Kurt Elmehed, »Unconscious facial reactions to emotional facial expressions«, in: Psychological Science, Band 11. 2000, S 86 – 89. ↩